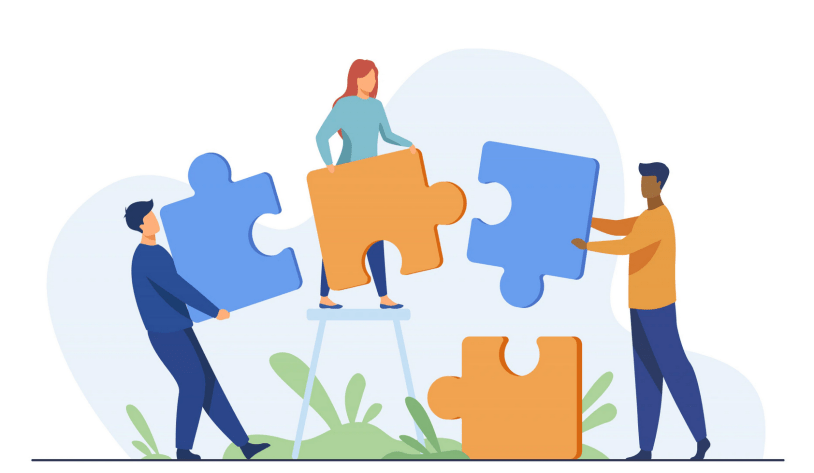Unter Moralentwicklung werden mit dem Psychologen Lawrence Kohlberg „jene Aspekte von Sozialisation [verstanden], die am Prozess der Internalisierung beteiligt sind, d.h. dazu führen, dass ein Individuum lernt, den Regeln auch in Situationen zu entsprechen, in denen es keine Überwachung und keine Sanktionen gibt – selbst wenn der Impuls geweckt wird, diese Regeln zu verletzen“ (Kohlberg 1995, S. 7). Bezüglich der Moralentwicklung können drei miteinander verbundene Dimensionen der Internalisierung unterschieden werden: Gefühls-, Verhaltens-und Urteilsdimension. Als Internalisierung kann man die Ebene bezeichnen, auf der Wissensbestände einer Person als implizit zu Verfügung stehen, d.h. dass sie ohne notwendig vorausgehende Reflektion handlungsleitend sind.
Gängige Unterteilungen von Programmen und Ansätzen zum „Ethischen Lernen“
In den deutschen Überblickarbeiten finden sich verschiedene Unterteilungen der vorliegenden Programme zur Werterziehung, von denen zwei kurz dargelegt werden sollen, um in Ansätzen deutlich zu machen, welche inhaltlichen und methodischen Konsequenzen aus der Entscheidung, den Fachunterricht im Bereich Sozial-, Moral- oder Demokratieerziehung zu positionieren, resultieren.
Mit Siegfried Uhl können die folgenden Typen von Programmen unterschieden werden, die je nach theoretischem Hintergrund die drei Dimensionen von Internalisierung verschieden stark zu beeinflussen suchen:
- Programme zur Förderung von Wissen und Einsicht und Wertaufklärungsverfahren: Hier soll die Vermittlung von Wissen zu und die Einsicht in Ideale und Wertsysteme und die Suche nach eigenen Wertüberzeugungen in Auseinandersetzung mit im Unterricht oder im pädagogischen Programm vorgegebenen Orientierungsrahmen die Bereitschaft erzeugen, sich emotional an Wertüberzeugungen zu binden26 (z.B. Wertklärung nach Raths 1976).
- Charaktererziehungsprogramme wollen gewohnheitsmäßig gutes Verhalten schaffen; durch Rollenspiele soll das Einfühlungsvermögen gefördert werden und das Nachahmen von Verhaltensmustern – in diesem Zusammenhang wurden Schulen als sogenannte Pro-Charakter-Schulen ausgewiesen (vgl. für Bundesland Bayern: „Schulen bilden auch Herz und Charakter“.
- In Diskussionsprogrammen wird die Urteilsfähigkeit trainiert, indem die Schüler mit Argumenten höherer Stufe gemäß dem Stufenkonzept Kohlbergs konfrontiert werden – dabei wird u.a. auch die Fähigkeit zur Rollenübernahme und zum fairen Austausch miteinander geübt.
- Just-Community-Programme (Gerechte Gemeinschaftsschule, vgl. u.a. Kohlberg 1995) suchen demokratisches Wissen und demokratische (moralische/soziale) Einstellungen über das Praktizieren demokratischer Verfahren zu vermitteln; Bestandteile sind u.a. die Einrichtung von Fairness-Komitees, gemeinschaftsstiftenden Ritualen und die Beteiligung aller an der Regelfindung für die Gemeinschaft.
Becker (2008) stellt fest, dass in der schulischen Sozial-, Moral- und Demokratieerziehung dieselben Tendenzen festzustellen seien wie in der Geschichte schulischen Lernens insgesamt: „Zunächst dominierten jeweils Lehrmethoden, bei denen die Lehrkraft die Aktivitäten der Schüler zu steuern sucht und die Formen passiven, nachvollziehenden Lernens beinhalten […]. In den 1970er Jahren gewannen Formen problembezogenen Lernens Einfluss, bei denen einsichtiges Lernen eine starken Stellenwert hat […]. Ab den 1980er Jahren fanden dann Formen handlungsbezogenen Lernens Resonanz […]“ (vgl. ausführlich: Becker 2008: 62ff.):
- traditionelle lerntheoretische Positionen umfassen Formen des Bestrafens und Belohnens (Lernen durch Bekräftigung) und des Vormachens (Lernen durch Nachahmung); hierunter fallen alle Ansätze der Charaktererziehung, die sich auf Wissen, Werteorientierung und Fertigkeiten beziehen (Lehrervortrag, fragend-entwickelndes Unterrichtsgespräch, Bekräftigung und Vorbildfunktion des Lehrers als Erziehungsmittel)
- den kognitivistisch-konstruktivistischen Positionen Kohlbergs und Selmans liegt in Anlehnung an Piagets Überlegungen zu den Beziehungen zwischen den Stufen des logischen Denkens und den Stufen des moralischen Urteilens eine Theorie der Entwicklung sozialer Kognitionen in Relation zur Perspektivübernahme unter folgenden entwicklungspsychologischen Annahmen zu Grunde:
- Kognitivismus: Denkprozesse (Kognitionen, Urteilsprozesse) beeinflussen maßgeblich Handlungsmotive, Gefühle und Handlungen.
- genetischer Strukturalismus: Entwicklung des Denkens ist Entwicklung grundlegender Organisationsmuster (Strukturen, Stufen), die aufeinander aufbauen und zunehmend größeres Problemlösepotential enthalten.
- kontextübergreifende Geltung: Die gleichen Sequenzen von Stufen (Strukturen) treten bei allen Problembereichen und sozialen Einheiten auf.
- Konstruktivismus: Notwendige Bedingung für die Entwicklung des Denkens sind kognitive Konflikte, die sich am jeweiligen Entwicklungsstand der Person, an ihrer Stufe des Denkens orientiert.
- handlungstheoretische Positionen orientieren sich stärker an kommunikativen, emotionalen und handlungsstrukturierenden Kompetenzen. Hintergrund sind u.a. die seit Anfang der 1990er geführten Debatten um die Liberalismus-Kritik durch die kommunitaristische Position und um das Verständnis von Bürgergesellschaft, Zivilgesellschaft und bürgerschaftliches Engagement, aus der seitdem eine umfangreiche Literatur zur Demokratieerziehung hervorgeht. An jüngeren Konzepte in Deutschland sind u.a. zu nennen: „Demokratie-Lernen“ (vgl. Himmelmann 2005; 2006), „Demokratisch Handeln“ (vgl. Beutel/Fauser 2001) und „Demokratie lernen & leben“ (vgl. Edelstein/Fauser 2001); der internationale Anschluss deutscher Konzepte erfolgte durch die Erklärung von 2005 zum „European Year of Citizenship through Education“ (vgl. ausführlich Becker 2008; in Auswahl: USA: „Citizenship Education“; GB: Nationales Curriculum „Education for Citizenship“, 1998; 1999; 2002); den Ansätzen ist im weiteren Sinne gemeinsam, dass sie integrative Ansätze sind, also frühere Programme, wie der oben vorgenommenen Aufteilung in Anlehnung an Uhl entsprechend, verbinden – wobei zu betonen ist, dass sich bereits in der den Ansätzen der strukturgenetisch-konstruktivistischen Tradition Piagets die handlungsorientierte Position zeigt (vgl. Just-Community-Ansatz).
In der Forschung wurde schon bald die kognitivistische Annahme eines engen Zusammenhangs von Urteilen und Handeln in Frage gestellt und es wurden verschiedene Modelle zur Überwindung bzw. zur Differenzierung des Urteils-Handlungszusammenhang-Problems vorgeschlagen; diese können aus heutiger Perspektive durchweg als kompetenzorientierte Ansätze angesehen werden, die über die Konzentration auf die Urteilskompetenz hinausgehen. So hat Selman (1984) mit dem Modell interpersonaler Verhandlungsstrategien den Kompetenzbegriff über die Urteilsbildung hinaus erweitert. Sein Ansatz wird von Adalbjarnardottir (1993; 2001) in die Schule übertragen in einem breiten Konzept von Förderungsstrategien, die auch die Diskussion alltagsbezogener Dilemmata beinhaltet. Keller/Reuss (Keller 1996; Keller/Reuss 1986) betonen in Anschluss an Habermas kommunikative Fähigkeiten und liefern hierbei ein zugleich strukturgenetisch-konstruktivistisches und handlungstheoretisches Modell verschiedener sozialer Fähigkeiten. In Kohlbergs Modell zum Zusammenhang zwischen moralischem Urteil und moralischem Handeln (Kohlberg 1984; in: Kohlberg 1995) rücken Fähigkeiten, wie die, eine soziale Situation bezüglich ihres moralischen Gehalts sensibel wahrzunehmen oder die, Urteile bezüglich der eigenen Verantwortlichkeit gegenüber dem moralisch Geboten zu fällen, was impliziert moralische Verantwortlichkeit zu empfinden und anschließend mit entsprechender Ich-Stärke konsistente Handlungen durchzuführen.
Dieser kurze Überblick sollte deutlich machen, dass im Bereich des wertorientierten Lernens Ansätze, die ausschließlich die Urteils- oder Bewertungskompetenz ins Zentrum setzen und deren Entwicklung durch Trainings gezielt anzusteuern suchen, zumindest problematisch sind.
Im Bereich der Sozial-, Moral- und Demokratieförderung liegen zudem verschiedene Vorschläge zur Beschreibung von Kompetenzen vor, die sich am „vor-domänenspezifischen“ Kompetenzmodell orientieren, von denen einer genauer ausgeführt werden soll. Nach CASEL (2008: 4) werden diese – ohne eine Unterscheidung von sozialen, moralischen und/oder demokratischen Kompetenzen vorzunehmen – differenziert nach:
- Selbstwahrnehmung: Erkennen eigener Gefühle, Erfassen und Pflege der eigenen Stärken und positiven Eigenschaften
- Soziale Wahrnehmung: Verständnis für Denken und Gefühle anderer und Anerkennung des Werts der Unterschiedlichkeit von Menschen
- Selbstmanagement: Steuerung der eigenen Gefühle, Setzung positiver Ziele und Streben danach
- Beziehungsfähigkeiten: Begründen und Aufrechterhalten bereichernder Beziehungen auf der Basis von Zusammenarbeit, effektiver Kommunikation und Konfliktlösung, und Fähigkeit, sozialem Druck zu widerstehen
- Fähigkeit zu verantwortungsvollen Entscheidungen: Einschätzung situativer Einflüsse; Entwicklung, Umsetzung und Beurteilung moralischer Problemlösungen, die das eigene Wohl und das Wohl anderer fördern
Becker (2008, S. 69f.) sieht den Aufschwung der Demokratieerziehung in den letzten drei Jahrzehnten in dem rasanten gesellschaftlichen Wandel und der Unsicherheit bezüglich verschiedener gesellschaftlicher Entwicklungstendenzen begründet; als Beispiel führt er das Projekt des Europarates „Education for Democratic Citizenship“ (nach Kerr/Losito 2004: 9f.) an, das die folgenden gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen hervorhebt:
- zunehmende ethnische Konflikte und Nationalismus, zunehmende globale Bedrohung und Unsicherheit,
- Entwicklung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien und das Konzept lebenslangen Lernens,
- Umweltprobleme, Bevölkerungsbewegungen innerhalb nationaler Grenzen und über diese hinweg,
- Auftreten neuer Formen zuvor unterdrückter kollektiver Identitäten,
- Forderungen nach stärkerer persönlicher Autonomie und neuen Formen sozialer Gerechtigkeit, Schwächung von sozialem Zusammenhalt und Solidarität, Auftreten neuer Gemeinschafts- und Protestformen,
- Misstrauen gegenüber traditionellen politischen Institutionen, Regierungsformen sowie politischen und gesellschaftlichen Führern,
- Zunahme der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Verknüpfungen und der wechselseitigen Abhängigkeit auf regionaler bis internationaler Ebene.
Zudem bestehe der zunehmendem Zwang, das demokratische System nach dem Zusammenbruch des Kommunimsus zum einen aus sich heraus und zum amderen gegenüber dem Erfolg neuer konkurrierender Systeme (z.B. Wirtschaftssysteme Chinas und Indiens) zu legitimieren.
Text: Stefan Applis (2022)
Bild: pch.vector – de.freepik.com
Literaturauswahl:
Adalbjarnardottir, S. (1993): Promoting children’s social growth in the schools: An intervention study. In: Journal of Applied Developmental Psychology, 14, pp. 461-484
Adalbjarnardottir, S. (2001): Zur Entwicklung von Lehrern und Schülern: Ein soziomoralischer Ansatz in der Schule. In: Edelstein, W., Oser, F.,/Schuster, P. (Hrsg.). (2001). Moralische Erziehung in der Schule: Entwicklungspsychologie und pädagogische Praxis. Weinheim, S. 213-232.
Becker, G. (2008): Soziale, moralische und demokratische Kompetenzen fördern. Ein Überblick über schulische Förderkonzepte. Weinheim und Basel.
Fauser, K., Fischer, A./Münchmeier, R. (2006): Jugendliche als Akteure im Verband. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung der Evangelischen Jugend. Opladen.
Keller, M. (1996): Moralische Sensibilität: Entwicklung in Freundschaft und Familie. Weinheim.
Keller/Reuss (1986): Der Prozess der moralischen Entscheidungsfindung. In: Oser, F./Fatke, R./Höffe, O. (Hrsg.) (1986): Transformation und Entwicklung. Frankfurt a. M., S. 124-148
Kohlberg, L. (1995): Die Psychologie der Moralentwicklung. Aufsatzsammlung. Frankfurt a. M.