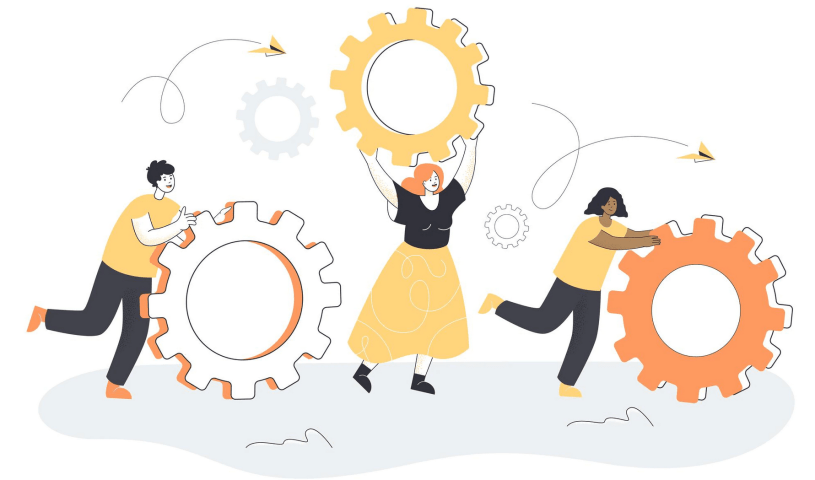Wozu dienen Bildungsstandards? Wie sind sie mit Kompetenzmodellen verknüpft?
Bildungsstandards legen fest, welche Kompetenzen Kinder oder Jugendlichen bis zu einer bestimmten Jahrgangsstufe mindestens erworben haben sollen. Diese Kompetenzen sind so konkret zu beschreiben, dass sie in Aufgabenstellungen umgesetzt und prinzipiell mit Hilfe von Testverfahren erfasst werden können. Die Darstellung von Kompetenzen innerhalb eines Lernbereiches oder Faches umfasst Teildimensionen und Niveaustufen und Kompetenzmodelle konkretisieren entsprechend Inhalte und Stufen der allgemeinen Bildung (= Schlüsselkompetenzen und Metakompetenzen) und der fachbezogenen Bildung (= domänenspezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Bewältigung spezifischer arbeits- und lebensweltbezogener Anforderungen, d. h. für den Schulunterricht z. B. Bildungsstandards Geographie, Bildungsstandards Deutsch, Mathematik usw). Sie „machen Aussagen über die Dimensionen und Stufen von Kompetenzen, die prinzipiell und mit Hilfe passender Aufgaben empirisch überprüft werden können. Kompetenzmodelle sind demzufolge wissenschaftliche Konstrukte“ (Klieme 2003: 628), die als solche pragmatische Antworten auf Konstruktions- und Legitimationsprobleme von Bildungs- und Lehrplandebatten geben, insofern sie „nicht nur Leistungsniveaus im Querschnitt, sondern auch Lernentwicklungen abbilden sollen“ (a.a.O.).
Zusammenfassung: Bildungsstandards formulieren Ziele von Können, Kompetenzmodelle bilden ab, wie sich diese Könnensziele oder Kompetenzen stufenweise entwickeln im Laufe der schulischen Bildung. Auf Grundlage von Kompetenzmodellen lassen sich für jede Jahrgangsstufe Jahr für Jahr neue, sich in Komplexität und Herausforderungsniveau steigernde Aufgaben konstruieren, die die Kompetenzentwicklung vorantreiben, diagnostizieren und prüfen können.
Zum Kompetenzbegriff als wissenschaftliches Konstrukt gibt es allerdings trotz oder wegen intensiver Forschungsarbeiten keine einheitliche Definition oder übereinstimmende Aussagen darüber, wie sich Kompetenz vermitteln und messen lässt (vgl. Edelmann/Tippelt 2004), da mehrere Ansätze konkurrieren und Vereinheitlichungen immer mit Vereinfachungen verbunden sind, die zwangsläufig strittig sind.
Weshalb gibt es kaum wissenschaftsbasierte Aufgaben für den Schulunterricht zur Förderung und Diagnose von Kompetenzen?
Zunächst einmal muss gesehen werden, dass es nur für wenigse Fächer wissenschaftsbasierte, d. h. erkenntnisgesättigte Bildungsstandards gibt. Dies liegt daran, dass die KMK (Kultusministerkonferenz) nur für die PISA-Fächer die Modellierung von Bildungsstandards finanziell gefördert hat, d. h. an den Universitäten wissenschaftliche Mitarbeiter*innen zur Erstellung von Bildungsstandards und damit verbundener Kompetenzmodelle finanziert hat. Eines der Fächer, die am meisten Fördermittel erhielten, war die Biologiedidaktik, da deren Forschung bereits über ein hohes internationales wissenschaftliches Niveau verfügte, was auch darauf zurückzuführen ist, dass international im Bereich der Forschung zum Lernen und Lehren in naturwissenschaftlichen Fächer sehr viel an hochwertiger Forschung vorlag (s. Bildungsstandards Biologie für den Mittleren Schulabschluss und Bildungsstandards im Fach Biologie für die Allgemeine Hochschulreife).
Ansatz zur Förderung der Bewertungskompetenz aus der Biologiedidaktik
Bewertungskompetenz fördern | Eine gute Entscheidung treffen am Beispiel der Wahl des Transportmittels zu einer touristischen Reise
Familie Reiselustig plant einen Ausflug nach Paris (für die Nach-Pandemie-Zeit) Der folgenden Unterrichtsvorschlag zur Einführung in ein Modell der Entscheidungsfindung thematisiert Flugreisen und deren ökologische Konsequenzen. Um eine (moralisch) gute…
Kompetenzmodell Systemkompetenz aus der Geographiedidaktik
Systemisches Denken testen und fördern im gesellschaftswissenschaftlichen Unterricht
Aufgabenformate im Unterricht – Lernaufgaben, Test- und Prüfungsaufgaben Doinggeoandethics-Autor Frank Fischer gibt im ersten der beiden Vorträöge, die in diesem Beitrag enthaltenen sind, zunächst einen Überblick zu verschiedenen Aufgabentypen. Im…
Dass manche Fächer, wie z. B. die Geographiedidaktik, Bildungsstandards haben, ohne PISA-Fächer gewesen zu sein, liegt daran, dass die Hochschuldidaktiker*innen dieser Fächer beschlossen haben, Bildungsstandards ohne Förderung zu erstellen, um in der Zukunft förderfähig zu sein, d. h. z. B. beim BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) oder bei der DFG (Deutsche Forschungsgesellschaft) Förderanträge zur Erstellung von Kompetenzmodellen einreichen zu können. Es ist wichtig zu verstehen, dass man nur auf Grundlage von evidenzbasierten Kompetenzmodellen kompetenzorientierte Aufgaben erstellen kann, die innerhalb der wissenschaftstheoretischen Rahmung valide Diagnosen erlauben und auf deren Basis auch valide Prüfungsformate erarbeitet werden können (s.o.). Ist dies nicht der Fall, bleiben – wie in fast allen Lehrplänen – Kompetenzformulierungen mehr oder weniger vage und die sich darauf beziehenden Prüfungen können letztendlich nicht als valide im Sinne eines wissenschaftlichen Kompetenzansatzes betrachten werden.
Die Bildungsinstitutionen mancher Bundesländer reagierten noch ehe genügend Forschung vorlag mit eigenen Ansätzen, die wissenschaftliche Bezüge bei der Fassung der den Lehrplänen zu Grunde liegenden Kompetenzkonzeption mehr oder weniger ausschlossen (vgl. Bayerisches „Kompetenzstrukturmodell“ des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung München):
Kompetenzmodelle dienen dazu, Bildungs- und Lernziele auf der Basis fachdidaktischer Konzepte und empirischer Erkenntnisse zu konkretisieren. Man unterscheidet Kompetenzstrukturmodelle, Kompetenzstufenmodelle und Kompetenzentwicklungsmodelle. Vor allem erstere sind für die Lehrplanarbeit und die spätere Unterrichtsplanung relevant und haben deshalb Eingang in die neuen bayerischen Lehrpläne gefunden.
ISB Bayern (2015). LehrplanPLUS – konkret, S. 11
Zwar bezieht man sich hier auf die Ausgangsdefinition von Kompetenz, wie sie in der KMK gefasst wurde und den darin gefassten Kompetenzbegriff, legt diese aber der Lehrplanarbeit in der Umsetzung nicht strukturiert zu Grunde: Die in derartigen Grundlagendokumenten angeführten Bezüge (s. oben stehendes Zitat) haben schon deswegen eher Bekenntnischarakter, weil im angeführten Beispiel zum Zeitpunkt der Lehrplanveröffentlichung des Bayerischen Lehrplan Plus noch für kaum ein Fach valide Kompetenzmodelle zur Verfügung standen, die Eingang in den Lehrplan hätten finden können. Insofern sind auch die Aufgaben, die von Seiten der Kultusbehörden zur Verfügung gestellt werden, nicht kompetenzmodellbasiert in einem wissenschaftlichen Sinne (s. o.).
Zusammenfassung: Wissenschaftliche Forschung und Lehrplanentwicklung vollziehen sich in institutionell getrennten Organsationsstrukturen (personell, räumlich, zeitlich). Dies macht eine Koordinierung von Bedürfnissen, Erkenntnissen und Handlungszielen schwierig. Die Folge war eine Entkoppelung der Aktivitäten bei der Deutung des PISA-Ergebnisse, der aus PISA gezogenen Schlussfolgerungen und davon ausgehend der Festlegung und Umsetzung der institutionsbezogenen Ziele. Das Universität und Schule in weitestgehend voneinander getrennten Welten operieren, wird auch als Theorie-Praxis-Problem bezeichnet.
Das Grundproblem der in der wissenschaftlichen Diskussion erarbeiteten Kompetenzmodelle liegt zum einen in deren Abstraktheit: Das macht es voraussetzungsreich, sie für den Einsatz im Unterricht durch Lehrer*innen anwendbar zu machen – die Folgen davon sind im Grunde einigermaßen banal : Lehrkräften, auch auf Ebene der kultusministeriellen Grundlagenarbeit fehlt die Zeit die vorhandenen Modelle grundlegend zu studieren und darauf aufbauen kompetenzorientierte Aufgaben zu entwickeln, den Fachidaktiker*innen fehlt es an Zeit und Personal, um selbst in hinreichender Zahl Beispielaufgaben bereitzustellen auf Grundlage der Forschung zur Kompetenzmodellentwicklung. In Folge dessen liegen kaum modellbasierte schulische Förderkonzepte vor, da viele Kompetenzmodelle nicht über den Theoriestatus oder den Status des empirisch noch nicht gesättigten Testinstruments hinaus sind.
Beides trägt dazu bei, einen großen Abstand zwischen Forschung, Curricula und dem pädagogischen Personal, den Lehrern, manifestieren zu müssen (s. o.), obgleich Kompetenzmodelle Diagnosewerkzeug sein sollten, um individuelle Förderung zu ermöglichen.
Warum und inwiefern wird sich in Kompetenzforschung nur auf einen Teil der Weinert-Definition bezogen?
Dabei wäre eine „differenzierte Bezugnahme auf Förderansätze […] notwendig, um aufzeigen zu können, wie Fortschritte bei der Kompetenzentwicklung erzielt werden können“ (Becker 2008, S. 61). Kompetenzraster sollten als Diagnoseinstrument eingesetzt werden, um den Unterricht methodisch und inhaltlich auf die Lerngruppe auszurichten.
In der Regel wird sich auf die Definition von Franz E. Weinert bezogen, wenn von Kompetenzen die Rede ist im Zusammenhang mit der Bestimmung von Bildungszielen:
„Kompetenzen sind die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“
Franz E. Weinert (Hrsg.): Leistungsmessung in Schulen. Weinheim und Basel: Beltz, 2001: 27f.
In einer früheren vergleichenden Arbeit über verschiedene Fassungen des Kompetenzbegriffs bezeichnet Weinert (1999) Kompetenz als eine kontextspezifische kognitive Leistungsdisposition, die eine Person befähigt, bereichs- und situationsspezifische Anforderungen zu bewältigen. Hier werden Kontextspezifität und kognitiver Schwerpunkt der Kompetenz betont. Zu Grunde liegt die Annahme, dass sich Kompetenzen als Wissensstrukturen in konkreten Handlungen dokumentieren, so dass die Bewältigung einer Handlung oder Aufgabe Grundlage der Kompetenzmessung sein könne. Hierzu passt, dass Weinert selbst nur zu solchen Aufgabenfeldern gearbeitet hat, der Verweis auf „die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten“ (Weinert 2001) rahmt also nur ein im Kern kognitionsorientiertes Leistungskonzept.
Der Vorteil dieser reduzierten Fassung, die im Bereich der Bildungsforschung die größte Bedeutung hat, ist, dass trotz ihrer Betonung der kognitiven Komponente die Grenze zum Begriff der Intelligenz gewahrt bleibt und dass motivationale und affektive Aspekte aus der Definition ausgeschlossen bleiben können. Es wird also vor allem Bezug auf solche Fähigkeiten und Fertigkeiten genommen, die grundsätzlich als trainierbar und lernbar angesehen werden und durch Interventionen beeinflussbar und durch Messinstrumente erfassbar sind (vgl. Hartig & Klieme 2006), also als weniger persönlichkeitsbezogen als volitionale (durch den Willen beeinflussbare), motivationale (antriebsorientierte) und soziale (kommunikationsorientierte) Aspekte angesehen werden können. Aus dem institutionellen Bedürfnis nach quantifizierbarer Erfassbarkeit und Evaluation heraus dominiert die Konzentration auf die kognitive Perspektive unter den derzeit entwickelten Kompetenzmodellen.
Warum führen Kompetenzansätze eher zu mehr (Leistungs-)Tests und weniger zu ganzheitlichen (sozialen) Förderansätzen? Sollen sozial-moralische Leistungen bewertet werden?
Auf bildungsinstitutioneller Ebene drückt sich dasselbe Bedürfnis in einer Zunahme von schulischen Leistungstests als Jahrgangsstufentests aus, die in allen Bundesländern durchgeführt werden. Auch hier konzentriert man sich auf quantifizierbare Erfassbarkeit, während die Förderung volitionaler und motivationaler Aspekt in den Hintergrund gedrängt wird.
Im Bereich der Sozial-, Moral- und Demokratieerziehung sind hingegen volitionale, motivationale und sozial-kommunikative Aspekte neben Persönlichkeitsmerkmalen von zentraler Bedeutung. Die Philosophie- und Ethikdidaktikerin Anita Rösch (2009) hat für die Fächergruppe Philosophie, Ethik, Praktische Philosophie, LER (Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde) und Werte und Normen auf Basis vorliegender psychologischer Stufenkonzepte ein Kompetenzmodell entwickelt und entsprechende Aufgaben vorgelegt (s. PP-Präsentation am Ende des Beitrages); sie fragt jedoch bezüglich der Operationalisierung volitionaler, motivationaler und sozialer Aspekte kritisch, „ob es überhaupt anstrebenswert ist, für alle diese Kompetenzen jahrgangsspezifische Mindest- und Regelstandards festzulegen. Kompetenzen bestehen nicht nur aus Wissen und Können, sondern beinhalten auch die Facetten Motivation und Haltung. Kann man diese Aspekte überprüfen? Lässt sich ein Lernfortschritt in diesem Bereich Altersstufen zuordnen? Ist es überhaupt anstrebenswert, diese Persönlichkeitseigenschaften zu evaluieren? Sollte man Leistungen in diesen Bereichen bewerten?“ (Rösch 2009, S. 16)
Handeln, in dem Kompetenz zum Ausdruck kommt, ist als solches aber etwas Ganzheitliches, in dem die Fähigkeit und Bereitschaft, eines Menschen, sach- und fachgerecht reflektiert in sozialer, d.h. in auf andere bezogener Verantwortung zu handeln und die Bereitschaft, seine Handlungsmöglichkeiten beständig weiterzuentwickeln zum Ausdruck kommt. Dieser Beschreibung folgend wird in der allgemeinen Pädagogik zwischen Sachkompetenz, Methodenkompetenz, sozialer Kompetenz und personaler oder Selbstkompetenz unterschieden. Sach- oder Fachkompetenz zielt auf den Erwerb von Wissen in verschiedenen Fachgebieten und deren Anwendung in darauf bezogenen Kontexten (Beruf, Schule, andere soziale Kontexte) mit entsprechenden anwendungsbezogenen Problemzusammenhängen. Sachkompetenz ist nur inhaltsbezogen zu bestimmen und in diesem Sinne Fachwissen. Im Zusammenhang des Erwerbs von Fachwissen wird Methodenkompetenz erworben, durch die das eigene Handeln gestaltet wird; hier ist zwischen fachspezifischen und überfachlichen Methoden zu unterscheiden. Wird dieses Wissen in Handlungssituationen eingebracht, ermöglicht es die soziale Kompetenz einer Person, bei unterschiedlichen Aufgaben und Problemstellungen, die eigenen Ziele und Interessen in Abstimmung mit den Zielen und Interessen der anderen Beteiligten erfolgreich umzusetzen. Hierzu sind personale Kompetenzen grundlegend, die Einstellungen, Werthaltungen, und Motivationen umfassen in Bezug auf die eigene Person und in Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl ihren Ausdruck finden.
Herausgebildet werden können Kompetenzen nur bezogen auf konkrete Anforderungssituationen. Sie umfassen ein Leistungsspektrum, sind daher nicht durch einzelne isolierte Leistungen dazustellen oder zu erfassen. Die Vielfältigkeit der Anwendungsmöglichkeiten erfordert es, dass die Entwicklung und Förderung von Kompetenzen eine ausreichende Breite von Lernkontexten, Aufgabenstellungen und Transfersituationen umfassen muss. Eng gefasste Leistungserwartungen werden dem Anspruch von Kompetenzmodellen nicht gerecht, eine reine Wissensabfrage kann eine Kompetenz nicht angemessen evaluieren.
Rösch, A. (2009): Kompetenzorientierung im Philosophie- und Ethikunterricht. Entwicklung eines Kompetenzmodells für die Fächergruppe Philosophie, Praktische Philosophie, Ethik, Werte und Normen, LER. Zürich, S. 32
In der Formulierung von der Bewältigung konkreter Anforderungssituationen, in denen Kompetenzen ihren Ausdruck finden und der gleichzeitigen Abgrenzung von zu engen fachorientierten isolierten Leistungen wird der Übergang zur Domänenspezifität (spezifischer Lernbereich, Fach) gefasst: Konkrete Lernkontexte müssen geschaffen werden, wozu eine spezifische Ausrichtung, d.h. Operationalisierung der allgemeinen Kompetenzen auf konkrete Domänen, Lernbereiche und Fächer notwendig ist. Im Bereich der Förderung sozialer, moralischer und demokratischer Kompetenzen geht es also um die Schaffung von Lehr-Lern-Kontexten, in denen eben solche Kompetenzen erworben werden können, d. h. um die Öffnung schulischen Unterrichts hin zu Just-Community-Ansätzen und handlungstheoretischen Positionen, bei denen die Vermittlung von konkreten Wissensinhalten in den Hintergrund tritt (vgl. Beitrag „Basics | Überblick zu Positionen der schulischen Moral-, Sozial und Demokratieerziehung„).
Zusammenfassung: Kritiker*innen von Bildungsstandards befürchten, dass mit dem Paradigmenwechsel von der Input- zur Output-Steuerung den Schulen noch lange keine Vorgaben über den Erwerb der Kompetenzen gemacht und damit Fragen nach dem Unterrichten auf die Schulen ausgelagert werden; es werde schlicht davon ausgegangen, dass Bildungsstandards ausreichend zur Kommunikation über die Erwartungen der Gesellschaft sind. Da sich auf Wissen und Können bezogene Kompetenzen für Lehrer*innen leichter operationalisieren lassen, ist es nahe liegend, dass sich diese auf die Entwicklung von Aufgaben im Sinne eines heimlichen Curriculums stützen und die erziehungswissenschaftlichen Aspekte von Bildungsstandards ausgeblendet werden: Das Interesse an pädagogisch motivierten Förderansätzen im Bereich sozialer, moralischer und demokratischer Kompetenzen tritt zurück, Testverfahren, die quantifizierbare Daten erzeugen nehmen zu.
Text: Stefan Applis (2022) unter Bezug auf Applis (2012)
Bild: pch.vector – www.freepik.com
Literatur
Applis, S. (2012). Wertorientierter Geographieunterricht im Kontext Globales Lernen. Theoretische Fundierung und empirische Untersuchung mit Hilfe der dokumentarischen Methode. (=Geographiedidaktische Forschungen, Bd. 51). Weingarten.
Becker, G. (2008): Soziale, moralische und demokratische Kompetenzen fördern. Ein Überblick über schulische Förderkonzepte. Weinheim und Basel.
Edelmann, D. & Tippelt, R. (2004): Kompetenz – Kompetenzmessung: ein (kritischer) Überblick. In: Durchblick. Zeitschrift für Ausbildung, Weiterbildung und berufliche Integration, 3, S. 7-10.
Hartig, J. & Klieme, E. (2006): Kompetenz und Kompetenzdiagnostik. In: Schweizer, K. (2006) (Hg.): Leistung und Leistungsdiagnostik. Berlin, S. 127-143
Klieme, E. et al. (2003): Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Eine Expertise. Bonn.
Rösch, A. (2009): Kompetenzorientierung im Philosophie- und Ethikunterricht. Entwicklung eines Kompetenzmodells für die Fächergruppe Philosophie, Praktische Philosophie, Ethik, Werte und Normen, LER. Zürich.
Weinert, F. E. (1999). Konzepte der Kompetenz. OECD: Paris.
Weiterführendes Material